Andrej Reisin hat dem Wissenschaftsjournalismus in einem Essay für Übermedien ein miserables Zeugnis ausgestellt. Laut Reisin hat die wissenschaftsjournalistische Szene in Deutschland im Umgang mit der Coronapandemie versagt.
Er kritisiert nicht einzelne Artikel, Medien oder Autor:innen – sondern gleich die ganze Szene, ein schwer fassbares Kollektiv von Wissenschaftsjournalist:innen. Unter anderem wirft er der Profession vor, sich aus einem kollektiven Dünkel heraus – wir haben Ahnung von Wissenschaft, alle anderen nicht – an die Lippen einiger weniger Wissenschaftler:innen geheftet und davon abweichende, aber durchaus plausible und legitime wissenschaftliche Positionen zu umstrittenen Fragen der Coronapandemie negiert zu haben.
Mit diesem Verhalten, in dessen Folge Wissenschaftsjournalist:innen von Leitmedien wie ZEIT, SPIEGEL, WDR oder Süddeutscher Zeitung Widersprüche, Lücken und Interessenskonflikte von Wissenschaftler:innen bewusst ignoriert hätten, habe der Wissenschaftsjournalismus letztlich sogar Verschwörungsdenken befeuert: Weil diese Journalist:innen sich den Status des wissenden Gatekeepers angemaßt haben, hätten sie die Diskussion durchaus plausibler Alternativen aus den „seriösen“ Medien ferngehalten und so erst den Eindruck erweckt, das wissenschaftsjournalistische Besserwisser-Kollektiv habe etwas zu verheimlichen. Reisins Essay gipfelt im schlimmsten Vorwurf, den man einer Gruppe von Journalist:innen nur machen kann. Er schreibt:
„Statt ein „Folgt der Wissenschaft!“ zu proklamieren, das am Ende doch nur die Wissenschaft meint, der man selbst gerade am liebsten folgen möchte, wäre es besser, wenn Wissenschaftsjournalismus es sich zwischen allen Stühlen unbequem machen und das Objekt seiner Berichterstattung genauso kritisch befragen würde, wie es die meisten Kolleg:innen und die Öffentlichkeit vom Politikjournalismus auch erwarten. Leichter wird das Geschäft dadurch nicht. Doch alles andere ist eben PR.“
Ein vernichtendes Urteil, sagt es doch unverhohlen, dass der Wissenschaftsjournalismus nicht in der Lage sei, journalistischen Qualitätsstandards zu genügen. Wissenschaftsjournalismus ist für Reisin eben deshalb gar kein Journalismus, sondern „verlängerte Wissenschafts-PR“ im Gewand des Journalismus, quasi der Feind im eigenen, journalistischen Lager.
Reisins Recherchen: Mangelhaft
Wer so apodiktisch und harsch über ein ganzes Kollektiv urteilt und ihm die Professionalität abspricht, sollte sehr gute Argumente auf seiner Seite haben. Die sucht man in dem Essay allerdings meist vergeblich, zudem finden sich so manche Fehler, die den Eindruck vermitteln, dass Reisin es weder mit der Recherche sehr genau nimmt, noch über jenes wissenschaftliche Fachwissen verfügt, dass es ihm erlauben würde, sich derart über die extrem herausfordernde Arbeit der wissenschaftsjournalistischen Szene im Weltereignis Pandemie zu erheben.
Fangen wir mit einer scheinbaren Petitesse an. Reisin kritisierte in der ursprünglichen Fassung seines Artikels unter anderem Volker Stollorz, Leiter des Science Media Centers Germany (SMC), dem laut Reisin im Jahr 2020 für seine wissenschaftsjournalistische Arbeit das Bundesverdienstkreuz verliehen wurde. Tatsächlich wurden Volker Stollorz und das SMC für ihre herausragende journalistische Arbeit mit Preisen ausgezeichnet, unter anderem erhielt das SMC 2020 den Sonderpreis des Netzwerks Recherche. Das Bundesverdienstkreuz allerdings hat Stollorz bisher nicht erhalten, weder 2020, noch davor. Es hätte sein können, mit Mai Thi Nguyen-Kim, die Reisin in seinem Essay ebenfalls stark kritisiert, ist 2020 tatsächlich eine Wissenschaftsjournalistin für ihre Arbeit mit dem Bundesverdienstkreuz ausgezeichnet worden. Die Tücke liegt hier – wie so oft – im Detail. Die Übermedien-Redaktion hat diesen Fehler inzwischen korrigiert, weil sie von einem Wissenschaftsjournalisten darauf aufmerksam gemacht wurde – so viel Ironie muss sein.
Fahrlässiges Desinteresse an der Laborhypothese?
Mit exakt diesem Muster lassen sich einige der „Belege“, mit denen Reisin zu zeigen beansprucht, dass der Wissenschaftsjournalismus seinen Job verfehlt hat, als Recherchefehler dechiffrieren. Dem ZEIT-Wissenschaftsjournalisten Andreas Sentker attestiert Reisin etwa fahrlässiges Desinteresse an der Frage, ob das Coronavirus auf natürlichem Wege entstanden oder einem chinesischen Labor entsprungen ist. Reisins Argument:
„Es ist aber eine durchaus lohnenswerte Aufgabe für den Wissenschaftsjournalismus, sich der Frage des Ursprungs von SARS-CoV-2 unvoreingenommen zu widmen. Stattdessen wird mehrheitlich abgewiegelt: Die Suche nach dem Ursprung der Pandemie sei fruchtlos, meint zum Beispiel Andreas Sentker, geschäftsführender Redakteur der „Zeit“ und seit 1998 Leiter des Ressorts Wissen: „Das Ziel von Seuchenfahndern ist es, Patient null zu finden, den ersten Menschen, der sich mit einer Krankheit infiziert hat. Bei Ebola dauerte diese Suche Jahrzehnte. Bei einer Krankheit, die weitgehend symptomlos übertragen werden kann, ist ein Erfolg nahezu ausgeschlossen.“ Das steht im bemerkenswerten Widerspruch zur durchaus erfolgreichen Suche bei SARS und MERS.“
Der Widerspruch, den Reisin konstruiert, ist jedoch keiner, denn SARS und MERS verlaufen extrem selten völlig symptomfrei, und daher lässt sich bei diesen zoonotischen Erkrankungen die Quelle der Infektionen im Tierreich grundsätzlich leichter ermitteln. Das heißt: Bei SARS und MERS konnte man mit Erfolg nach „Patient null“ und dem Infektionssprung vom Tier auf den Menschen suchen, weil so gut wie jeder Infizierte Krankheitssymptome zeigte. Auch hier gilt wieder: Die Tücke liegt im Detail – und im umfangreichen Orientierungswissen, dass eine Vertrautheit mit dem Stand der wissenschaftlichen Erkenntnisse bedingt. Die Aussage von Andreas Sentker ist insofern korrekt, die Reisinsche Analogiebildung zwischen verschiedenen Krankheiten klingt dagegen nur dann plausibel, wenn man das Wissen um die Entstehung zoonotischer Infektionserkrankungen ignoriert bzw. nicht kennt.
Ein weiteres Beispiel? Reisin glaubt in Wissenschaft und im Wissenschaftsjournalismus ein „Pochen auf Autorität“ diagnostizieren zu können, kritische Nachfragen würden zu schnell unter den Tisch gekehrt. Dabei übersieht er jedoch, dass es in der Wissenschaft und entsprechend auch in der Beobachtung der Wissenschaft durch Journalismus wesentlich um Belege für Hypothesen und nicht um bloße Meinungen gehen sollte.
False balance falsch verstanden
Ein häufiges Problem in der Berichterstattung ist die „false balance“. Machen wir es mit einem Beispiel deutlich: Bei der Frage nach den Ursachen des Klimawandels gibt es die längst widerlegte Hypothese, dass die Sonnenflecken für die Erderwärmung verantwortlich seien. Und es gibt einen überwältigenden Konsens von Klimawissenschaftlern, die auf verschiedenen Wegen belegt haben, dass anthropogen verursachte Treibhausgase die Erwärmung verursachen. Heutige Wissenschaftsjournalist:innen werden den Anhängern der Sonnenflecken-Theorie kein Forum mehr bieten. Sie werden die Vielfalt der Stimmen verringern, alles andere wäre „false balance“. Während eine Pluralität von Meinungen in weiten Bereichen der politischen Debatte durchaus ein Wert ist, geht es in der Wissenschaft – und oft auch im Wissenschaftsjournalismus – um die Suche nach der richtigen Hypothese, der richtigen Antwort und die Belege zu einer konkreten Frage. Noch einfacher: Zwei plus zwei ist nun einmal vier. Wer etwas anderes behauptet, muss nicht ständig gehört oder zitiert werden. Außer wenn es darum geht zu erklären, mit welcher Erkenntnistheorie „Flat Earther“ beweisen, dass die Erde eine Scheibe ist.
Natürlich gibt es in den Wissenschaften legitimen Streit um Argumente, z.B. wenn epistemische Unsicherheit herrscht, es an verlässlichen Daten mangelt, Modelle die Wirklichkeit nicht widerspiegeln können oder interdisziplinäre Kontroversen toben bezogen auf einen Erkenntnisgegenstand. Als wesentliche Voraussetzung für produktive Kritik und organisierte Skepsis innerhalb der integren Wissenschaft gilt jedoch, dass der Kritiker versuchen muss, Fehler in den Argumenten des Kritisierten aufzuzeigen. Aus einer solchen Kritik resultiert erst eine fruchtbare und lösungsorientierte Debatte. Genau das ist bis heute zum Beispiel bei der Frage nach der Infektiosität von Kindern der Kern der wissenschaftlichen Diskussion – ein Sachverhalt, den Reisin unterschlägt. Stattdessen diagnostiziert er eine interdisziplinäre Kontroverse, wo es im Kern um die schwierige Abwägung zwischen dem unbestrittenen Wert der Bildung und der virologisch und epidemiologisch zu klärenden Frage geht, wie stark Kinder in Schulen am Infektionsgeschehen teilhaben – ohne selber schwer zu erkranken. Ersteres hängt von Einschätzungen, Werten und gesellschaftlichen Prioritäten ab, letzteres lässt sich naturwissenschaftlich klären.
Nicht jede Stimme verdient Beachtung nur weil sie vom Mainstream abweicht
Reisin schreibt selbst, es spreche sehr viel für die These, dass der Ursprung des Coronavirus eine Zoonose und kein Laborunfall ist – wobei er übrigens unterschlägt, dass es zwischen Bioterrorismus, einer Manipulation durch „Gain of Function“-Experimente, dem Passagieren verwandter Fledermausviren in menschlichen Zellkulturen oder in Labortieren oder einem fahrlässigen Umgang mit Sicherheitsroutinen im Labor in Wuhan entscheidende Unterschiede gibt. Dennoch kritisiert er den Wissenschaftsjournalismus dafür, dass er dem Hamburger Physik-Professor Roland Wiesendanger nicht mehr Aufmerksamkeit gewidmet habe, der doch Autor einer Studie sei, die den Laborursprung zu belegen gesucht habe. Wie charakterisiert Reisin selbst die Qualität der Arbeit Wiesendangers?
„Seine Methode bestand jedoch aus willkürlichem Ineinanderkopieren von wissenschaftlichen Quellen, chinesischen Social-Media-Screenshots, der „Epoch Times“ und anderer Artefakte, die am Ende nur ein Sammelsurium darstellen, das nichts belegt.“
Muss man wirklich noch begründen, warum man Wiesendangers Paper vor diesem Hintergrund für das hält, was es de facto ist, nämlich vernachlässigbarer Forschungsmüll? Für Reisin liegt die Sache offenbar anders, und schon die Begründung dafür ist bemerkenswert. Für Reisin sind Stimmen wie jene von Wiesendanger einfach deshalb interessant und somit unbedingt berichtenswert, weil sie abweichen vom Mainstream. Diese Normabweichung erst generiert den Nachrichtenwert, sie sei gar „Symptom für eine Lücke im Diskurs“. Wer das – wie der Wissenschaftsjournalismus – mehrheitlich nicht schnallt und deshalb Wiesendanger weitgehend ignoriert, verfehle seinen Beruf, denn er interessiere sich nicht für die Diskurslücke. Offenbar folgt Reisin hier einem Journalismuskonzept, das er für so selbstverständlich hält, dass ein Abweichen davon für ihn einem beruflichen Versagen gleichkommt. Denkt man das zu Ende, also dass man selbst einem zusammenkopierten Sammelsurium, das nichts belegt, journalistische Aufmerksamkeit schenken muss, wird deutlich, wie absurd das Reisinsche Journalismusverständnis ist. Es spielt letztlich das perfide Spiel aller Verschwörungstheorien mit, demzufolge jedes Argument in der journalistischen Arena, mag es noch so dumm sein, aufgegriffen werden müsse. Wenn nicht, mache man sich der Zensur schuldig und maße sich laut Reisin zudem die Hybris an, entscheiden zu können, wer massenmedial sichtbar wird und wer nicht.
Dem Ursprung des Virus auf der Spur
Selbstverständlich kann und muss man der Frage nach dem Ursprung des Virus weiter nachgehen. Wissenschaftsjournalist:innen haben das in der Vergangenheit national und vor allem international getan und tun es weiterhin – zum Beispiel durchaus prominent und sehr früh in dem Artikel „Woher kam das Virus?“ in der FAZ. Letztlich kann diese Frage aber nicht allein von Wissenschaftsjournalist:innen beantwortet werden, sondern erfordert eine intensive Zusammenarbeit von Kolleginnen und Kollegen aus dem Investigativ-, Wissenschafts-, und Politikressort, weil viele interessierte Kreise in dieser Auseinandersetzung Informationen lancieren oder zurückhalten, deren letztgültige journalistische Überprüfung schwierig ist. Solange aber die Qualität der und der Zugang zu Informationen nicht besser wird, lässt sich die Frage eben nicht klären, vor allem nicht durch munteres Ventilieren von Spekulationen aus Quellen, deren Herkunft sich nicht seriös überprüfen lässt, wie unlängst der Wissenschaftsjournalist Joachim-Müller-Jung in einem Artikel zum Virusursprung mit dem bezeichnenden Titel „Die Rache der Ideologen an der Virologie“ erläutert hat.
Auswahl von Expert:innen zentraler Teil der Profession
Bei aller Bescheidenheit: Wer nicht unterscheiden kann, wem man als Wissenschaftsjournalist:in Gehör schenkt und wem nicht, der und die hat in diesem anspruchsvollen Beruf nichts zu suchen. Was Reisin als Arroganz der wissenschaftsjournalistischen Kaste geißelt, nämlich die Begrenzung der Auswahl von Expert:innen, ist vielmehr zentraler Teil ihrer professionellen Rolle im öffentlichen Debattenraum. Gute Wissenschaftsjournalist:innen zeichnen sich gerade dadurch aus, dass sie domainspezifische, also fachliche Expertise erkennen, also begründen können, warum man einer bestimmten Position gerade in einer Situation erheblicher Unsicherheiten begründetes Vertrauen entgegen bringen kann. Wer wie Reisin das nicht nur nicht versteht, sondern im Gegenteil sogar der Meinung ist, jeder Inhaber eines Lehrstuhls sei bei der Suche nach Antworten auf komplexe Fragen willkommen, begreift weder, was gute Wissenschaft ausmacht, noch welche unverzichtbare Lotsenfunktion für öffentliche Debatten Wissenschaftsjournalist:innen hier einnehmen. Wenn Reisin das Ergebnis wissenschaftsjournalistischer Recherche nur als „merkwürdige Form von Gatekeeping“ lesen kann, die infolge einer überheblichen Dünkelhaftigkeit letztlich nur einfältiges Gruppendenken befördere, der dokumentiert mit diesen Urteilen vor allem, dass er vollends aus den Augen verloren hat, warum es im Journalismus geht: Die ersten drei “Elements of Journalism” in dem Klassiker der Journalisten Kovach und Rosenstiel lauten: “Journalism first obligation is to the truth, its first loyalty to citizens, its essence is a discipline of verification.”
Reisin blendet aus, dass viele Akteure in der Öffentlichkeit mitnichten darauf abzielen, die Erkenntnissuche voranzutreiben, sondern eigene Interessen und Ziele verfolgen. Die Einwände richten sich nicht an die Wissenschaft, sondern an Politik, Öffentlichkeit und Entscheidungsträger. Im Zweifel für den Zweifel, heißt der Schlachtruf aller Populisten im Umgang mit unbequemer Wissenschaft. „Flood the zone with shit“, so spitzte es Steve Bannon zu, der ehemalige Chefstratege von Donald Trump. Es geht bei diesem toxischen Zweifel meist darum, Nichthandeln selbst dort nahezulegen, wo die Evidenzen der Wissenschaft mit Blick auf mögliche Handlungsfolgen ziemlich eindeutig sind. Das haben Diskurse wie die um den menschengemachten Klimawandel und die Risiken des Rauchens über Jahrzehnte gezeigt. Diese Form der pseudowissenschaftlichen Kritik findet sich typischerweise in der Religion, in der Politik oder auch im Gerichtssaal. Aus diesen sozialen Zusammenhängen wissen wir, dass dabei zumeist nicht fachlich versierte Forschende überzeugt werden sollen, sondern Menschen, die dem angeblichen Zwist in der Wissenschaft nur zuschauen und die Stichhaltigkeit der Kritik sachlich kaum beurteilen können. Eben deshalb ist es im öffentlichen Umgang mit wissenschaftlichem Wissen ein perfider und leider in öffentlichen Debatten besonders wirksamer Weg, Außenstehende für sich zu gewinnen, indem man den „Gegner“ falsch darstellt. Denn erst wenn man dessen Position weniger glaubwürdig erscheinen lässt, als sie es tatsächlich ist, entsteht die erwünschte Verwirrung. Genau so geht Reisin mit dem Wissenschaftsjournalismus um, indem er einen Strohmann zeichnet, um die Normen der Profession im Gestus der Investigation aus den Angeln heben zu können. Applaus bekommt er dabei erwartbar von denen, die den Umgang mit der Pandemie als komplett übertrieben darstellen.
Mit vernünftiger Recherche in kakophone Räume eindringen
In der Tat ist die Wissenschaft keine Demokratie, sondern ein Ort der methodischen Suche nach den besten Argumenten. Solche Argumente zeichnen sich dadurch aus, dass man sie nur mit schlechteren Gründen ignorieren kann. Für viele öffentliche Debatten mit Bezug zur Wissenschaft ist charakteristisch, dass wir mit einer Vielzahl an Positionen und Meinungen konfrontiert sind, also ein kakophoner Raum entsteht, der Orientierung und damit auch das Treffen vernünftiger Entscheidungen massiv erschwert. Die „merkwürdige Art von Gatekeeping“, die Reisin dem Wissenschaftsjournalismus vorwirft, nun als Ausdruck von willkürlicher Diskursverengung durch selbst ernannte News-Torwächter zu diskreditieren, missversteht gründlich, worum es geht, wenn man mit wissenschaftsjournalistischen Recherchen in diese kakophonen Räume interveniert.
Es geht in der professionellen Beobachtung der Wissenschaft eben nicht um Diskursverengung, sondern um bestmögliche Orientierung, so sie denn in Form begründeterer Expertise identifizierbar ist. Natürlich unterliegt diese Orientierungsleistung in einem Umfeld echter epistemischer Unsicherheiten und stetig wechselnder Erkenntnisse einer hohen Dynamik. Nicht alles, was gestern bestmögliches Wissen war, hält dem Erkenntnisfortschritt in den Wissenschaften stand. Aber diese ex-post-Einsicht ist billig. Denn es ist ja geradezu die entscheidende Stärke einer integren Wissenschaft, dass sie revidierbar bleibt. Und es ist eine Stärke des Wissenschaftsjournalismus, das immer wieder deutlich zu machen.
Der Anspruch des Qualitäts-Wissenschaftsjournalismus ist deshalb nicht, ewige Wahrheiten aus dem Munde weniger Koryphäen zu verbreiten, sondern bestmögliches, d.h. gut begründetes Wissen zu einem Zeitpunkt zu identifizieren, in dem Gesellschaften offene Fragen haben. In dem kollektive Entscheidungen getroffen und möglichst begründete Handlungen eruiert werden müssen. Mit Wissenschafts-PR hat das nichts zu tun, es sei denn, man verwechselt – wie Reisin – das Resultat dieser anspruchsvollen Rechercheleistung von Journalist:innen mit distanzloser Liebe zu ihrem Berichterstattungsgegenstand. Wer so denkt, muss allerdings erklären, mit welchen Methoden er denn stattdessen eine begründete von einer unsinnigen Position unterscheiden möchte. Würfeln? Oder wenn viele Expert:innen A sagen, irgendeinen finden, der Nicht-A für richtig hält? Oder von A bis Z alles berichten, was auf dem Markt der Meinungen verfügbar ist?
Das Beispiel Hendrik Streeck
Besonders deutlich wird dieses fundamentale Missverständnis an der Stelle im Text, an der Reisin den Virologen Hendrik Streeck zu Ehren kommen lässt. Er ist für ihn das Paradebeispiel dafür, wie Wissenschaftsjournalist:innen ihre Diskursmacht missbrauchen. Streeck habe seine Studie über das Pandemiegeschehen in Gangelt in einer renommierten Fachzeitschrift veröffentlicht, sei unter Fachkollegen weitgehend unwidersprochen geblieben und werde von den Wissenschaftsjournalist:innen dennoch nicht in gleicher Weise als Experte konsultiert wie etwa Christian Drosten. Diese Geschichte ist zu falsch, um wahr zu sein. Streeck war zu Beginn der Pandemie-Berichterstattung ein auch von Wissenschaftsjournalist:innen häufig konsultierter Virologe. Aber Streeck als HIV-Forscher ist in der Wissenschaft damit noch kein ausgewiesener Coronaviren-Experte gewesen wie Christian Drosten, der bereits vor Beginn der Pandemie viele Jahre an Coronaviren geforscht hatte. Insofern wundert es auch nicht, dass Drostens Urteil zunächst mehr Raum eingeräumt wurde als dem vieler anderer Virolog:innen. Die wachsende Kritik an Streeck war zudem nicht das Ergebnis einer fragwürdigen wissenschaftsjournalistischen Gatekeeping-Praxis, sondern allein dem Umstand geschuldet, dass Streeck sich sowohl mit Blick auf die Gangelt-Studie, als auch mit anderen fachlichen Einschätzungen zum Coronageschehen selbst vielfältiger fachlicher Kritik ausgesetzt gesehen hat, in der Öffentlichkeit ebenso wie in der Wissenschaft selbst.
So bleibt zum Beispiel bis heute unklar, ob die in „Nature Communication“ berechnete Infektionssterblichkeit für Gangelt ein Studienartefakt ist. Trotz aller Kritik ist Streeck zudem als öffentlicher Experte mitnichten verschwunden, Reisin bemüht hier fragwürdige Omnipotenzphantasien mit Blick auf die Gatekeeping-Macht von Wissenschaftsjournalist:innen. Aber in der Tat ist die Bedeutung Streecks als Forschender für viele Fragen rund um den Themenkomplex Corona aus guten Gründen geringer geworden als zu Beginn. Dazu hat sicher auch beigetragen, dass Hendrik Streeck seine Gangelt-Studie durch die PR-Agentur StoryMachine begleiten ließ – und die ersten Ergebnisse noch vor Veröffentlichung eines wissenschaftlichen Preprint-Papers bei einer Pressekonferenz des NRW-Ministerpräsidenten Armin Laschet präsentierte. Es waren übrigens Wissenschaftsjournalist:innen, die damals die Kritik an diesem Vorgehen formulierten und Zweifel an den Studienergebnissen begründeten – unter anderem Florian Schumann und Dagny Lüdemann in der Zeit oder Hinnerk Feldwisch-Drentrup auf Medwatch. Wenn aber die Grenzen von Wissenschaft und Politik dermaßen verschwimmen, sollten nicht allein Wissenschaftsjournalist:innen misstrauisch werden – und Aussagen besonders kritisch prüfen.
Wo Kritik am Wissenschaftsjournalismus greift
Wer also im Detail nachschaut, der reibt sich verwundert die Augen über die harschen und undifferenzierten Vorwürfe an die gesamte Branche der Wissenschaftsjournalist:innen. Ist also alles falsch, was Reisin kritisch über den Wissenschaftsjournalismus schreibt? Natürlich nicht. Die Kritik an der desaströsen Datenlage zur wichtigen Soziodemographie der Pandemie hätte im Wissenschaftsjournalismus früher thematisiert werden können. Der Umgang des professionellen Wissenschaftsjournalismus mit den Geistes- und Sozialwissenschaften bleibt ein Stiefkind, vertiefende Recherchen zu den Schwachstellen der Pandemiepolitik bleiben ein Desiderat.
Aber die Reisinsche Hauptthese, dass Deutschland durch den Gatekeeper Wissenschaftsjournalismus einseitig oder gar falsch orientiert wurde, entbehrt jeder Grundlage – ganz im Gegenteil. Angesichts von bisher fast 90.000 Todesfällen nach Corona-Infektionen, trotz aller ergriffenen Maßnahmen, die Schlimmeres verhütet haben, schließen wir uns der Einschätzung an, die Volker Stollorz in der ZEIT geäußert hat:
„Am Ende empfinde ich es als Niederlage, dass es den vielen gewissenhaft arbeitenden Wissenschaftsjournalisten in Deutschland und den Forschenden im Herbst nicht länger gelungen ist, ihrem Publikum den breiten fachlichen Konsens über die drohende winterliche Welle klarzumachen. Zu übermächtig waren in vielen Medien die Reflexe, jede Einschätzung aus der Wissenschaft mit einer Gegenposition zu kontrastieren und ungeprüfte Forschungsergebnisse aus Einzelstudien uneingeordnet zu vermelden, sodass sie Zweifel an dem weckten, was längst wissenschaftlicher Konsens war.“
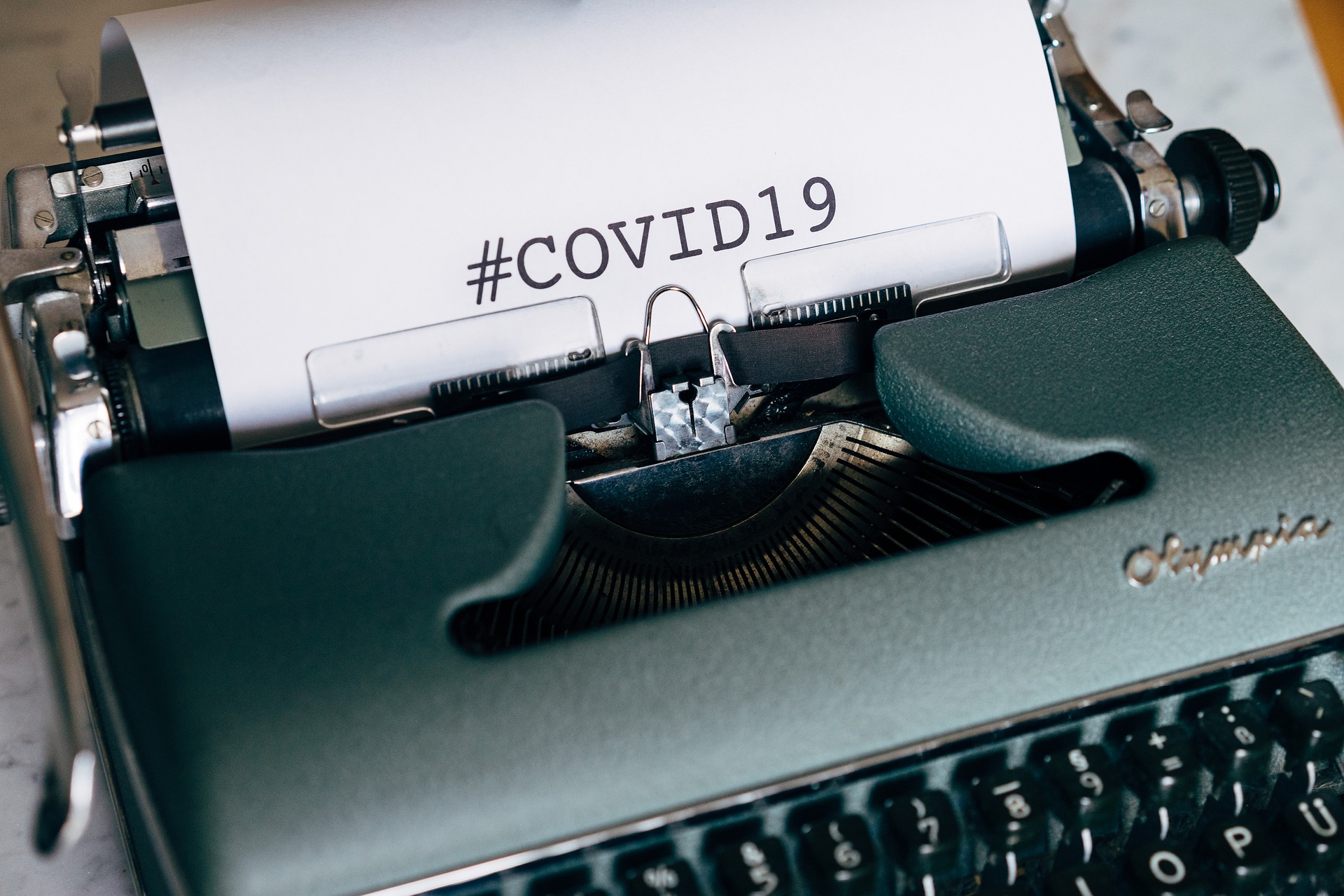




 Hallo liebe Kollegen,
Hallo liebe Kollegen,